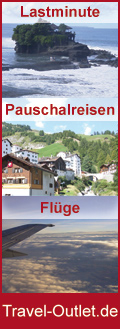Im 8. Jahrhundert werden in Forchheim ein fränkischer Königshof und eine Pfalz errichtet. Im Jahr 805 wird die Stadt im Diedenhofener Kapitular von Karl dem Großen erstmalig urkundlich erwähnt.
In den folgenden Jahrhunderten finden in Forchheim zahlreiche Reichstage und Fürstenversammlungen statt. Am 10. November 911 wird Konrad I. in Forchheim zum ersten „deutschen“ König gewählt und gekrönt.
Am 1. November 1007 schenkt Kaiser Heinrich II. das Königsgut Forchheim dem Bistum Bamberg. Bereits 1039 jedoch stellt Kaiser Heinrich III. die Stadt wieder unter Reichsverwaltung, bevor Forchheim am 13. Juli 1063 endgültig bis zur Säkularisierung 1802/1803 mit dem Bistum Bamberg verbunden wird. In der Zeit Heinrichs IV. wird am 15. März 1077 in Forchheim Rudolf von Rheinfelden als Gegenkönig gewählt („Canossagang“). In der Zeit zwischen 1200 und 1220 wird Forchheim zur Stadt erhoben und erhält sein jetziges Wappen.
Am 6. September 1802 wird die Stadt von bayerischen Truppen
Über viele Jahrhunderte hinweg wurde die Legende gepflegt, dass die Stadt Geburtsort des Pontius Pilatus gewesen sei, wovon auch der lateinische Spruch zeugt, der auf einem Stein der Stadtmauer gestanden haben soll: „Forchhemii natus est Pontius ille Pilatus,/Teutonicae gentis, crucifixor omnipotentis“.
Die stattliche Jubiläumszahl „1200“ bezieht sich auf die erste urkundliche Erwähnung des Ortsnamens Forchheim im Jahr 805. Die Quelle ist ein Kapitular Kaiser Karls des Großen, in dem der Waffenhandel mit den Slawen und Awaren untersagt und diesbezüglich auch auf bestimmte Grenzorte bzw. Handelsplätze verwiesen wird: Neben Bardowick, Schesel, Magdeburg, Erfurt, Hallstadt, Premberg, Regensburg und Lorch ist auch Foracheim (in einer Ausfertigung Forahheim), das bedeutet ,Föhrenheim‘, genannt.
Die Besiedelung des verkehrsgünstigen Topos an den Mündungen von Wiesent und Trubbach in die Regnitz muss natürlich früher angesetzt werden, so weist etwa der Name der Regnitz auf eine bereits frühgeschichtliche Begehung dieses Flusstales. Die keltische Kultur im Forchheimer Raum belegen z. B. Siedlungsspuren auf der nahen Ehrenbürg („Walberla“)
Die Ersterwähnung Forchheims im Kapitular Karls des Großen ist vor jenem Hintergrund der strategischen Lage des Ortes gegenüber dem Slawenland zu sehen. Als das Reich im Vertrag von Verdun 843 in Italien, West- und Ostfranken aufgeteilt wurde, Ludwig II., genannt „der Deutsche“, den Ostteil regierte und sich bevorzugt in Regensburg aufhielt, entwickelte sich Forchheim zu einer Reisepfalz: Die verkehrsgünstige Lage zwischen dem bayerischen Hauptort Regensburg und dem bedeutenden Frankfurt am Main erwies sich dabei als ausschlaggebender Faktor. Mit Ludwig weilte um das Jahr 850 erstmals ein König in Forchheim; sein Besuch eröffnete bis zum Jahr 1149 eine beeindruckende Reihe von 24 königlichen Aufenthalten - eine Zahl, die viele berühmte Orte nicht erreichen und sogar drei Königserhebungen (900, 911 und 1077) beinhaltet.
Ludwig machte Forchheim zum reichspolitischen Schauplatz, vor allem wenn es um Beziehungen mit östlichen Nachbarn ging, so schloss er hier 874 den „Forchheimer Frieden“ mit dem großmährischen Fürsten Swatopluk (Zwentibold). Weiteren Bedeutungszuwachs erhielt Forchheim unter Arnulf von Kärnten (König 887 - 899, Kaiser ab 896), dessen Urkunden dem Ort ausdrücklich das Prädikat „königlich“ zusprechen.
Der Enkel Ludwigs des Deutschen suchte Forchheim unmittelbar nach seiner Erhebung zu Frankfurt im November 887 auf dem Weg nach Regensburg das erste Mal auf. Erneut wurde die günstige Lage Forchheims zwischen diesen beiden Zentren und zugleich an der Nahtstelle von Franken und Bayern als ausschlaggebendes Kriterium erkennbar. Arnulf kam insgesamt fünf Mal hierher, unter anderem zu zwei Herrschertreffen.
Das Erlöschen der karolingischen Dynastie im ostfränkischen Reichsteil, Ludwig war mit 18 Jahren kinderlos gestorben, führte zu einer grundlegenden Veränderung: Die deutschsprachigen Stämme erhoben am 10. November 911 zu Forchheim den Franken Konrad I. unter Missachtung des Erbrechts auf den Thron und führten somit den endgültigen Bruch mit der karolingischen Linie Westfrankens herbei.
Wenn auch der Name Forchheims durch die Konrad-Wahl mit der deutschen Reichsgeschichte fortan fest verbunden blieb, wurde damit dennoch der Niedergang der Pfalz in Forchheim eingeleitet: Da ab nun der Stamm der Sachsen einen wichtigen Faktor darstellte, verschob sich die Machtachse des Reiches nach Norden ins Rhein-Main-Gebiet. Das faktisch bedeutungslos gewordene Königsgut Forchheim wurde in Konsequenz daraus 1007 zur Ausstattung an das neugegründete Bistum Bamberg gegeben.
Die alte Rolle des Ortes lebte 1077 im Investiturstreit nochmals auf, als hier Rudolf von Schwaben zum Gegenkönig Heinrichs IV. gekrönt wurde. Offenbar hatte man sich den alten Königswahlort Forchheim als Legitimationshilfe ausgedacht. Bis heute ist nicht geklärt, wo genau sich die Pfalz befunden hat. Als möglicher Standort wird der Bereich um die St. Martins-Kirche oder die Nähe von Burk am gegenüberliegenden Ufer der Regnitz erwogen.
Zu einer Erfolgsgeschichte entwickelte sich das 1840 ins Leben gerufene Annafest: Vielfalt und Qualität der hiesigen Biere sowie die einmalige Lage des Fest- und Kellergeländes üben bis heute eine beispiellose Anziehung aus.
In der zweiten Hälfte des 19. Jh. erreichte die industrielle Gründungswelle das Städtchen an der Wiesent: Wasserkraft und Wasserreichtum, aber auch die Lage an der Bahnlinie
Nach dem 2. Weltkrieg verdoppelte sich durch den Zustrom von Heimatvertriebenen die Einwohnerzahl nahezu, und wieder entstanden neue Industrieanlagen. Durch die bayerischen Gebietsreformen von 1972 und 1978 kamen die Gemeinden Reuth, Kersbach, Buckenhofen und Burk zur „Großen Kreisstadt Forchheim“, wie deren offizieller Status nunmehr heißt. Mit ca. 31.000 Einwohnern ist Forchheim heute Sitz des gleichnamigen Landkreises, in dem über 115.000 Menschen wohnen.